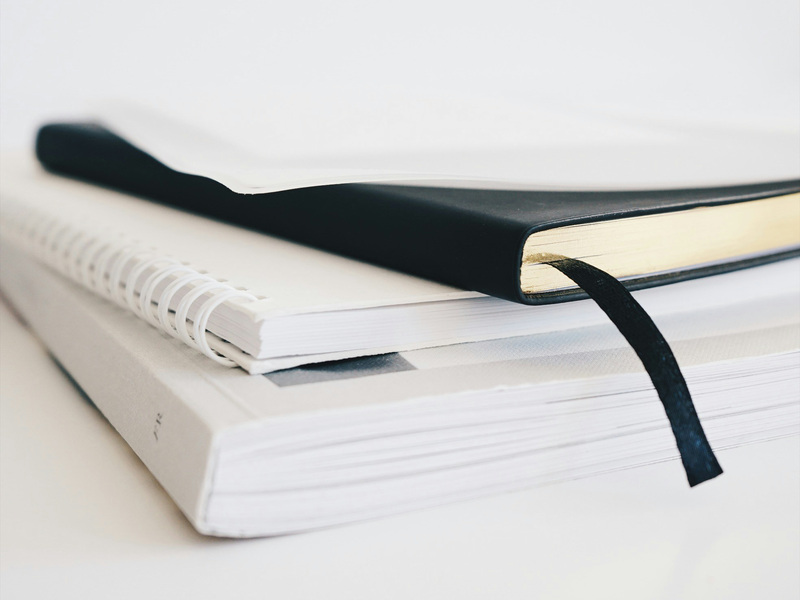Da hat man gerade die Geschenkeschlacht hinter sich gebracht, und der trocken gewordene Weihnachtsbaum nadelt herrlich den Wohnzimmerboden voll. Nicht auszudenken, wenn sich bei dem gerade verschenkten Greifspielzeug für die Kleinsten verschluckbare Kleinteile lösen und Erstickungsgefahr droht oder sich herausstellt, dass ein unter dem Baum sitzender Teddybär gesundheitsgefährdende Stoffe absondert, die über den Grenzwerten liegen. Auch über professionelles Instagram-Marketing beworbene Haartrockengeräte, Crêpes-Maschinen, Akku-Bohrmaschinen oder – sicher schwierig in Geschenkpapier zu hüllende – E-Scooter, die explodieren, Feuer fangen oder im besten Fall erst einmal „nur“ eine gefälschte CE-Kennzeichnung aufweisen, können die besinnlichen Feiertage erheblich stören – und zwar nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für die Inanspruchgenommenen und deren Haftpflichtversicherer.
Nicht immer sind diese Produkte über international tätige Online-Händler und -Marktplätze aus Singapur oder Shanghai geliefert worden. Gleichwohl stellt sich natürlich in jedem Fall die Frage, wer für gefährliche Produkte zu belangen ist. Zwangsläufig wirft das für deutsche und internationale Haftpflichtversicherer die Frage auf, inwiefern mit dem Verbreiten gefährlicher Produkte im Inland ein erhöhtes Risiko einhergeht und was eigentlich aus dem Regress werden kann.
Pünktlich zu Weihnachten haben sich auf Ebene des Produkthaftungs- und Produktsicherheitsrechts Neuerungen ergeben:
Die neue Produkthaftungsrichtlinie der EU 2024/2853 (ProdHaftRL) ist am 9.Dezember 2024 in Kraft getreten. Die Mitgliedstaaten haben bis zum 9. Dezember 2026 Zeit, die neuen Vorschriften in nationales Recht umzusetzen. Die Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 gilt bereits seit dem 13. Dezember 2024 unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten. Es gibt nicht nur eine Verknüpfung zwischen Produkthaftungs- und Produktsicherheitsrecht, sondern ein gemeinsames Ziel, nämlich den Schutz vor gefährlichen Produkten.
Produktsicherheit soll im Vorhinein Gefahren vermeiden, Produkthaftung sorgt für die Entschädigung in Folge eines Schadens. Die Verbindung zwischen den beiden Regelungswerken sorgt dafür, dass das Produktsicherheitsrecht im Wege des private enforcement durchgesetzt werden kann. Das wiederum ist auch Gedanke der zwischenzeitlich umgesetzten Verbandsklagenrichtlinie, die beide Regelungswerke zu ihrem Anwendungsbereich zählt.
Unmittelbarster Ausdruck für die Verknüpfung ist der Umstand, dass ein Fehler nach Artikel 7 Absatz 1 ProdHaftRL vorliegen soll, wenn ein Produkt nicht die Sicherheit bietet, die „gemäß Unionsrecht oder nationalem Recht vorgeschrieben“ ist. Spannend ist in dem Kontext auch die Frage, inwiefern das Produktsicherheitsrecht die in der ProdHaftRL vorgesehenen Haftungsausschlüsse beeinflusst. Darauf kann hier allerdings nicht vertieft eingegangen werden.
Letztlich unverändert bleibt die ProdHaftRL bei dem strengen Grundsatz der verschuldensunabhängigen Haftung und einem eher weiten Produktbegriff, der jetzt aber auch digitale Konstruktionsunterlagen, Rohstoffe und Software einbezieht. Gerade weil mit eingangs genannten, teils asiatischen Online-Plattformen gefährliche Produkte Gegenstand von über diese Plattformen abgewickelten Kaufverträgen sind und Eingang in die EU finden, zielt die neue ProdHaftRL darauf ab, für die Geschädigten sicherzustellen, dass stets ein Unternehmen mit Sitz in der EU als Haftungssubjekt verfügbar ist.
Bedeutsam ist Artikel 8 ProdHaftRL, der die haftenden Wirtschaftsakteure auflistet. Neu ist, dass neben den bislang schon haftenden Beteiligten zukünftig auch Bevollmächtigte haften, wenn der Hersteller des fehlerhaften Produkts außerhalb der EU niedergelassen ist, und der sogenannte Fulfilment-Dienstleister, wenn der Hersteller außerhalb der EU niedergelassen ist und auch weder Importeur mit Sitz in der EU noch Bevollmächtigter vorhanden ist. Auch der Händler bleibt subsidiär haftbar, wenn weder Hersteller und Importeur noch Bevollmächtigter und Fulfilment-Dienstleister mit Sitz in der EU ermittelt werden können.
Gleichwohl kann er sich auch in der Situation noch enthaften, wenn er fristgemäß auf Aufforderung einen (EU-)Wirtschaftsakteur gemäß Artikel 8 Absatz 1 ProdHaftRL oder jedenfalls seinen eigenen Lieferanten benennt. Anbieter von Online-Plattformen, die den Abschluss von Kaufverträgen ermöglichen, werden Händlern gleichgestellt. Sie haben damit zwar Haftungssubjektqualität, können sich aber im Einzelfall entlasten. Bisherige Haftungshöchstbeträge und Selbstbeteiligung bei Sachbeschädigung, geregelt im deutschen Produkthaftungsgesetz, müssen zukünftig ersatzlos wegfallen.
Das, was wir alle an Weihnachten machen müssen die Hersteller in Zukunft möglicherweise auch: auspacken. In Brüssel hat man sich zugunsten der häufig bestehenden Beweisschwierigkeiten auf Geschädigtenseite für eine noch nie da gewesene Kombination aus Offenlegungspflichten (schon jetzt wird gestritten, ob über das Maß von der Paragrafen 142ff. der Zivilprozessordung hinaus) und Beweislastregelung entschieden.
Als für das deutsche (Prozess-)Recht durchaus als exotisch zu bezeichnen (mit Ausnahme der 9. GWB-Novelle im Kartellrecht für Kartellschadenersatzklagen) ist eine Regelung in Artikel 9 ProdHaftRL: Entgegen der Kritik im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass der Beklagte bei vorgetragener Plausibilität des Schadenersatzanspruchs unter Umständen die in seiner Verfügungsgewalt befindlichen relevanten Beweismittel offenlegen muss.
Gegenstand können beispielsweise technische Unterlagen, Risikobewertung etc. sein, so dass sich auch hier der Kreis zu den nach der neuen Produktsicherheitsverordnung erweiterten Prüf- und Dokumentationspflichten schließt. An einige aus den USA bekannte, sogenannte Discovery-Regeln erinnern stark sowohl die – zwar schon nach bisherigem Recht mögliche, nach neuem Recht aber mit neuer Dynamik daherkommende – Behandlung von Online-Händlern als dem Hersteller gleichgestellt als auch diese Offenlegungspflichten.
Auch wenn damit keine Haftungsszenarien nach US-Vorbild und nicht unmittelbar eine Welle an nuclear verdicts drohen dürften, so lassen die Neuerungen im Produkthaftungs- und Produktsicherheitsrecht aber spätestens zum Weihnachtsfest in zwei Jahren – gerade auch in Verbindung mit der Umsetzung der Verbandsklagenrichtlinie – einen erheblichen Anstieg an produkthaftungsrechtlichen Inanspruchnahmen erwarten.
Darauf bereiten sich Online-Händler und Hersteller sowie deren Versicherer besser bereits jetzt vor. Noch ist es nicht zu spät, den Versicherungsschutz für diese Risiken zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen. In haftungsrechtlicher Hinsicht bleiben die konkrete Umsetzung der Richtlinie und das Zusammenspiel mit der Produktsicherheitsverordnung abzuwarten, und im nächsten Schritt müssen wohl die Gerichte die diversen schon abzusehenden Streitigkeiten mit Blick auf die unbestimmten Rechtsbegriffe klären.