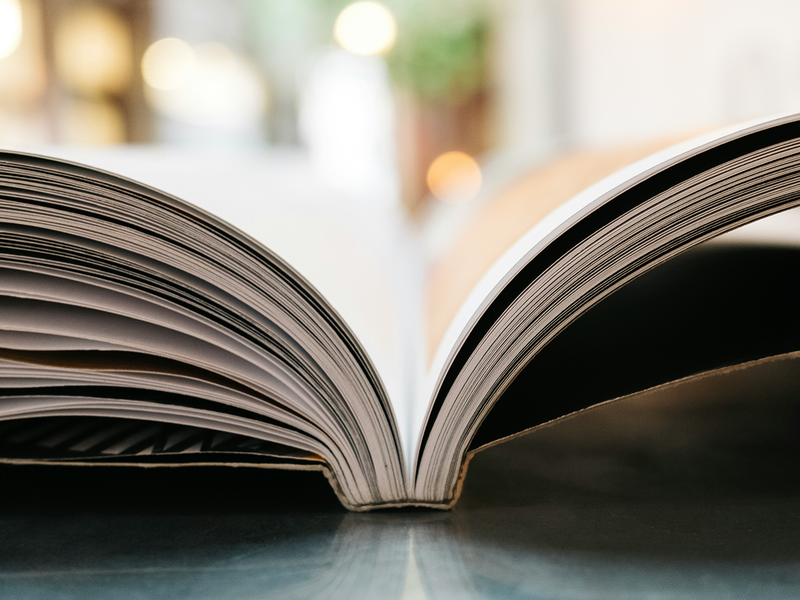Direktanspruch weltweit – Haftpflicht ohne Umweg?
In der Betriebshaftpflichtversicherung ist der Direktanspruch des Geschädigten gegen den Versicherer des Schädigers praktisch auf die Insolvenz des Versicherungsnehmers beschränkt. Die internationale Rechtslage ist anders: Artikel 18 der Rom II-Verordnung ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen einen solchen Direktanspruch. Die schlechte Nachricht für die deutschen Versicherer: Das Recht vieler ausländischer Staaten sieht einen solchen Direktanspruch vor! Der Bundesgerichtshof hat sich kürzlich mit der Frage befasst, unter welchen Voraussetzungen der Anwendungsbereich von Artikel 18 Rom II-Verordnung eröffnet ist.
Der wesentliche Sachverhalt des Rechtsstreits ist auf den ersten Blick recht unspektakulär: Die Versicherungsnehmerin der Klägerin mit Sitz in Deutschland schloss mit der ersten Beklagten, einem polnischen Transportunternehmen, einen Frachtvertrag, beauftragte sie mit der Beförderung des Frachtguts innerhalb Deutschlands und übergab ihr das beförderte Gut in einwandfreiem Zustand. An den Empfänger wurde das Frachtgut aber beschädigt geliefert. Die Klägerin beglich den Schaden des Auftragsgebers der Versicherungsnehmerin und verlangt nun von der ersten Beklagten und auch von ihrem polnischen Haftpflichtversicherer, der zweiten Beklagten, gesamtschuldnerisch Ersatz der gezahlten Beträge.
Aber kann die Klägerin den Haftpflichtversicherer des Transportunternehmens überhaupt direkt in Anspruch nehmen? Das deutsche Versicherungsvertragsgesetz jedenfalls kennt nur drei Fälle, in denen der geschädigte Dritte seinen Schadenersatzanspruch unmittelbar gegen den Versicherer des Schädigers geltend machen kann. Diese Fälle sind abschließend in Paragraf 115 Absatz 1 Satz 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) geregelt.
Der Streitfall wird von dem Anwendungsbereich dieser Norm nicht erfasst: Zwar ist der zwischen den Beklagten bestehende Transportversicherungsvertrag eine Pflichtversicherung gemäß Paragraf 7a Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), es gibt aber keine Pflicht zu deren Abschluss nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die weiteren Fälle des Paragrafen 115 Absatz 1 Satz 1 VVG, die in Nummer 2 und 3 geregelt sind, waren ebenfalls nicht einschlägig.
Die Klägerin hielt ihren Direktanspruch gegen die zweite Beklagte aber aus einem anderen Grund für begründet: Artikel 18 der Rom II-Verordnung (VO), die regelt, welches Recht bei grenzüberschreitenden außervertraglichen Schuldverhältnissen zur Anwendung kommt, gewährt dem Geschädigten nämlich das Recht, seinen Anspruch direkt gegen den Versicherer des Haftenden geltend zu machen, wenn dies nach dem auf das außervertragliche Schuldverhältnis oder nach dem auf den Versicherungsvertrag anzuwendenden Recht vorgesehen ist. Und das polnische Recht sieht einen solchen Direktanspruch gerade vor.
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat einen Direktanspruch gegen den gegnerischen Betriebshaftpflichtversicherer gleichwohl verneint (Urteil vom 20. Februar 2025, Az. I ZR 39/24). Er erläutert, in welchen Fällen der Anwendungsbereich von Artikel 18 Rom II-VO eröffnet ist: Um zu bestimmen, ob ein Kläger unmittelbar gegen den Versicherer des Haftenden klagen kann, ist zu prüfen, ob eine Direktklage zulässig ist – entweder nach dem auf das außervertragliche Schuldverhältnis anzuwendenden Recht oder nach dem auf den zwischen dem Haftenden und seinem Versicherer geschlossenen Versicherungsvertrag anzuwendenden Recht.
Direktanspruch nach dem Recht des außervertraglichen Schuldverhältnisses
Das Schuldverhältnis zwischen dem Geschädigten (Versicherungsnehmer) und dem Haftenden (erste Beklagte) muss außervertraglicher Natur sein. Versicherungsnehmer und Beklagte haben aber einen Frachtvertrag geschlossen. Unter Anwendung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zur Abgrenzung von vertraglichen und außervertraglichen Ansprüchen (Stichwort: freiwillig eingegangene Verpflichtung) hat der BGH hier das Vorliegen eines Vertrages bejaht und damit den Anwendungsbereich des Artikels 18 Rom II-VO verneint.
Er hat an dieser Stelle aber nicht die Frage aufgeworfen, ob sich aus dem Sachverhalt gegebenenfalls auch außervertragliche Ansprüche ergeben könnten. Das zöge dann die weitere Frage nach sich, ob unter diesen Voraussetzungen der Anwendungsbereich des Artikels 18 Rom II-VO eröffnet ist.
Direktanspruch nach dem Recht des Versicherungsvertrages
Ohne im Weiteren zu erörtern, ob er sich im Anwendungsbereich der Rom II-VO bewegt, stellt der BGH dann fest, dass ein Direktanspruch auch nicht nach dem Recht vorgesehen ist, das auf den Versicherungsvertrag anzuwenden ist. Dieser zwischen den in Polen ansässigen Beklagten geschlossene Versicherungsvertrag unterliege – entgegen der ersten Annahme wegen des gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthaltes – nicht etwa dem polnischen, sondern dem deutschen Recht. Dies ergebe sich aus Artikel 7 Absatz 4b Rom I-VO und aus Artikel 46d Absatz 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB).
Und nun schließt sich der Kreis zu dem bereits eingangs Gesagten: Zwar ist die Versicherung für Haftung für Güter- und Verspätungsschäden eine Pflichtversicherung im Sinne von Paragraf 113 Absatz 1 VVG, nicht aber im Sinne von Paragraf 115 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 VVG. Das hat zur Folge, dass das deutsche Recht keinen Direktanspruch gegen den Haftpflichtversicherer vorsieht.
Ausblick und offene Frage
Im Einzelfall ist also stets genau zu prüfen, ob ein vertragliches oder ein außervertragliches Schuldverhältnis Gegenstand der Streitfrage ist und welches Recht auf das außervertragliche Schuldverhältnis und auf den Versicherungsvertrag zwischen dem in Anspruch Genommenen und dessen Haftpflichtversicherer Anwendung findet.
Der BGH musste sich in der Entscheidung nicht mit der Frage befassen, ob deutsche Versicherer nun Sorge haben müssen vor einer nachträglichen Rechtswahl zugunsten eines Rechts, das einen Direktanspruch kennt. Wird das Deliktsstatut durch Rechtswahl nach Artikel 14 Rom II-VO bestimmt, bleiben die Rechte Dritter nach Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 aE Rom II-VO grundsätzlich unberührt. Stimmt also der Versicherer der Rechtswahl nicht zu, so sollte sich der Direktanspruch trotz (nachträglicher) Rechtswahl nach dem objektiven Deliktsstatut richten. Einer „Rechtserschleichung“ kann damit wirksam entgegengetreten werden.